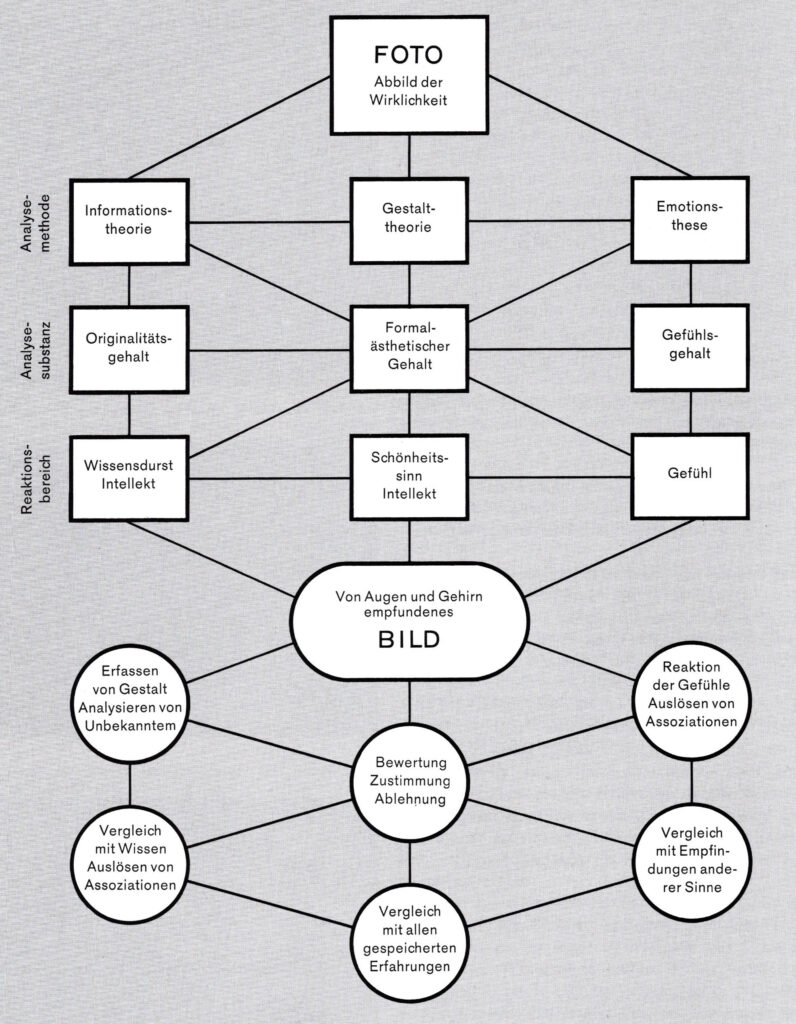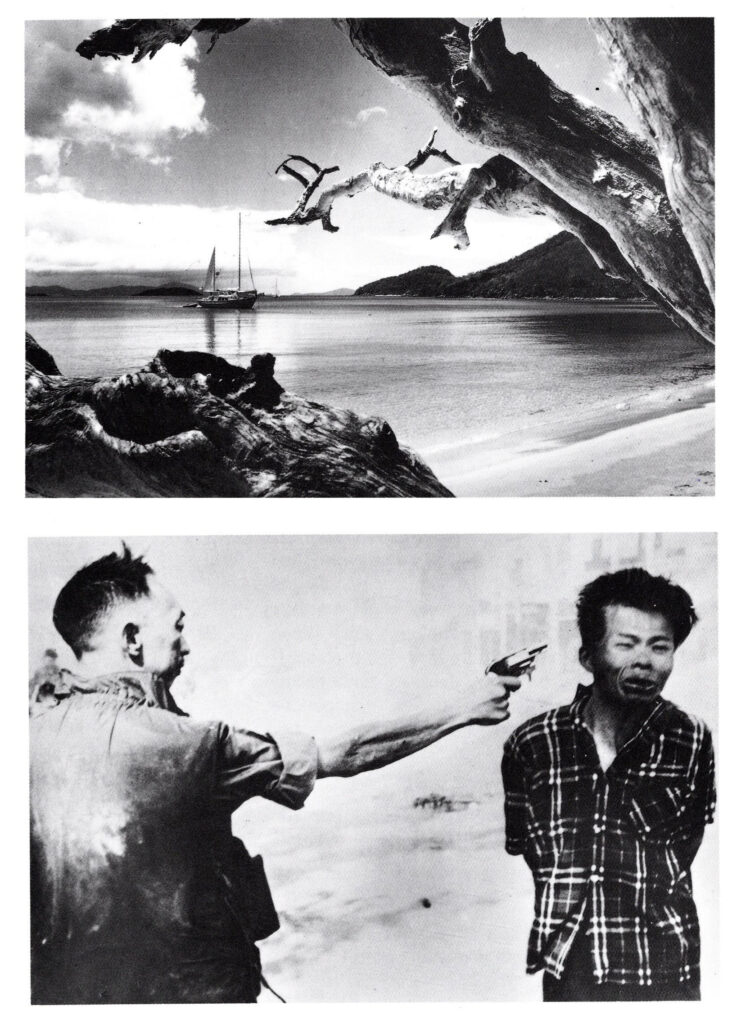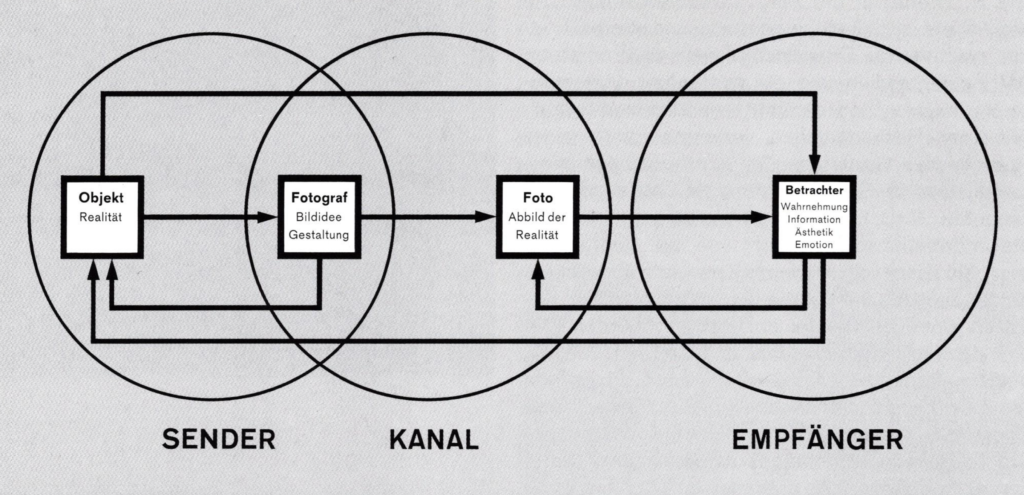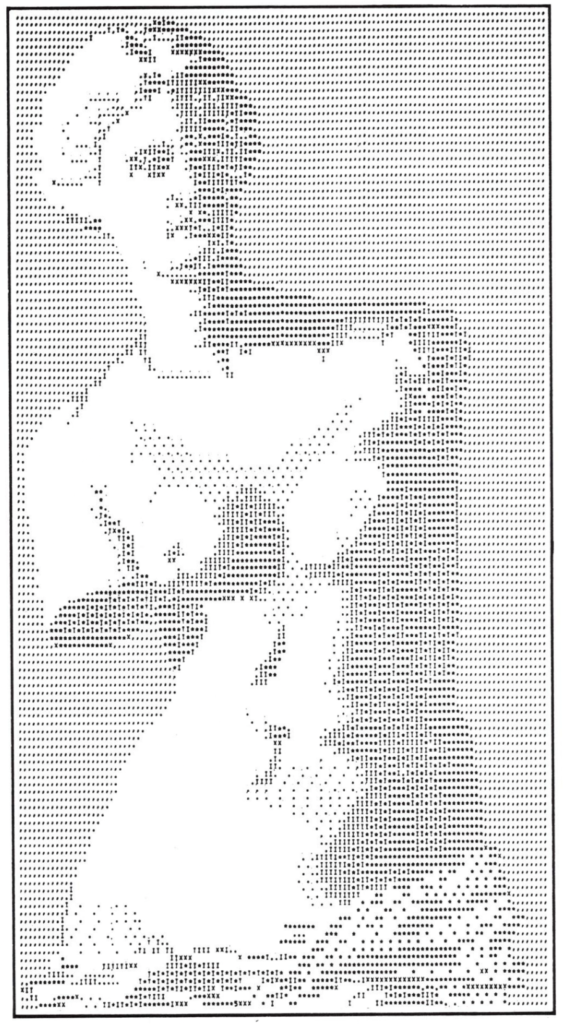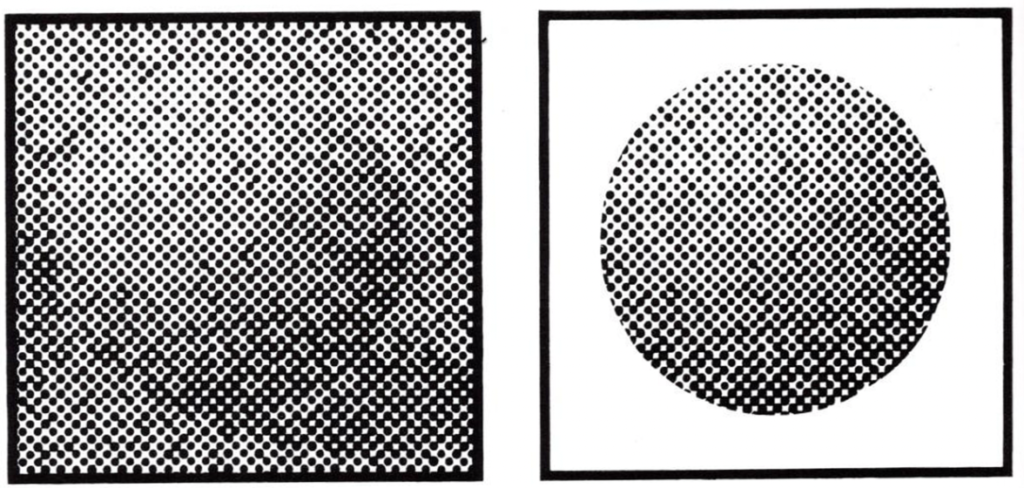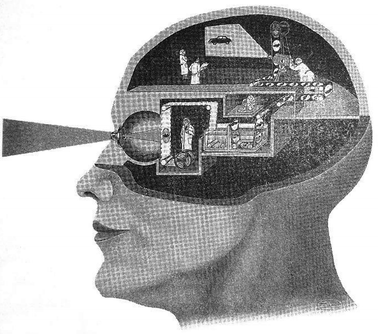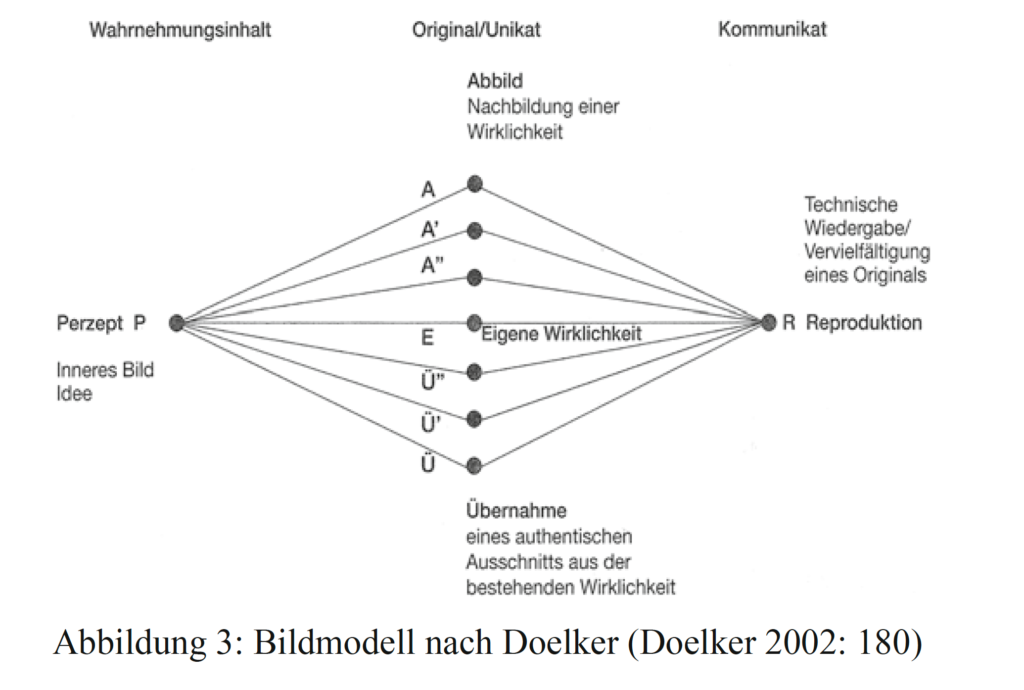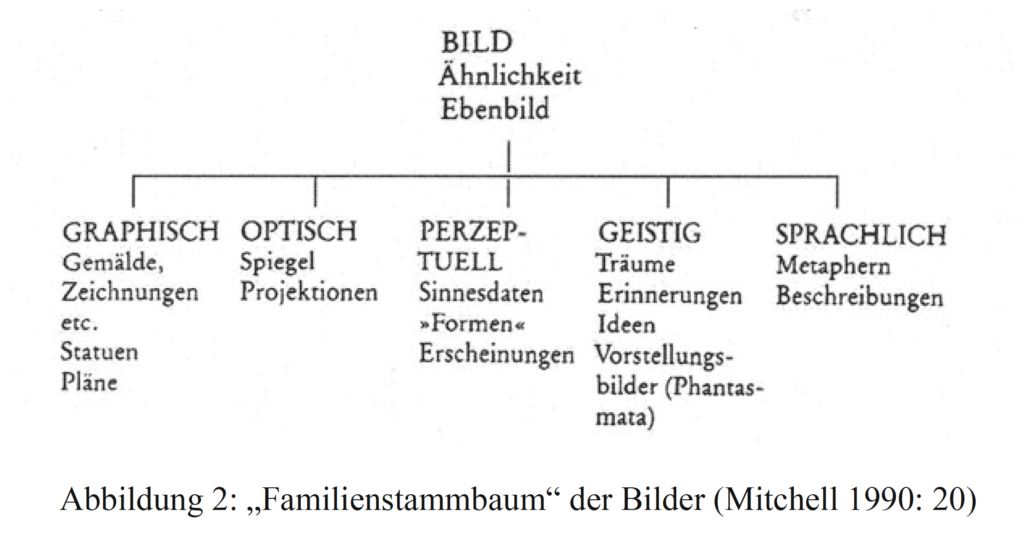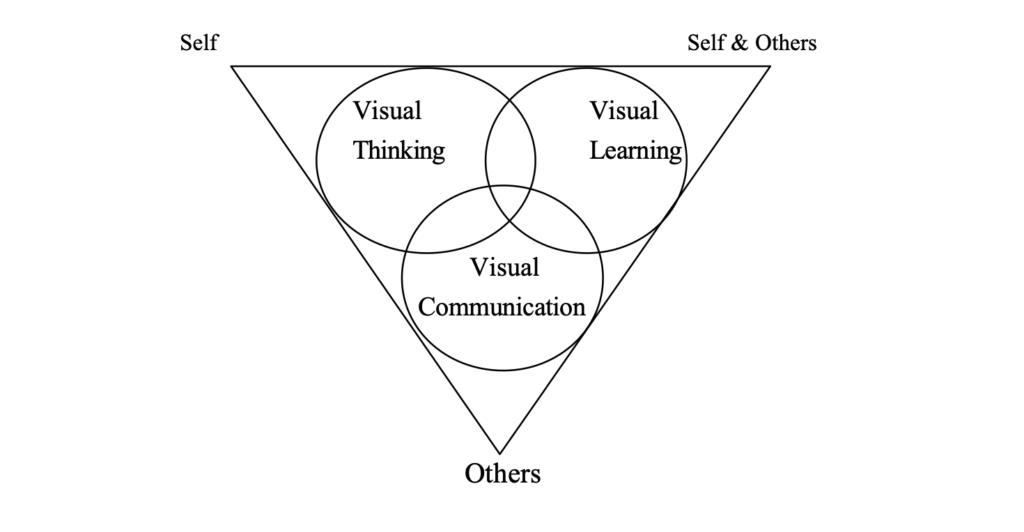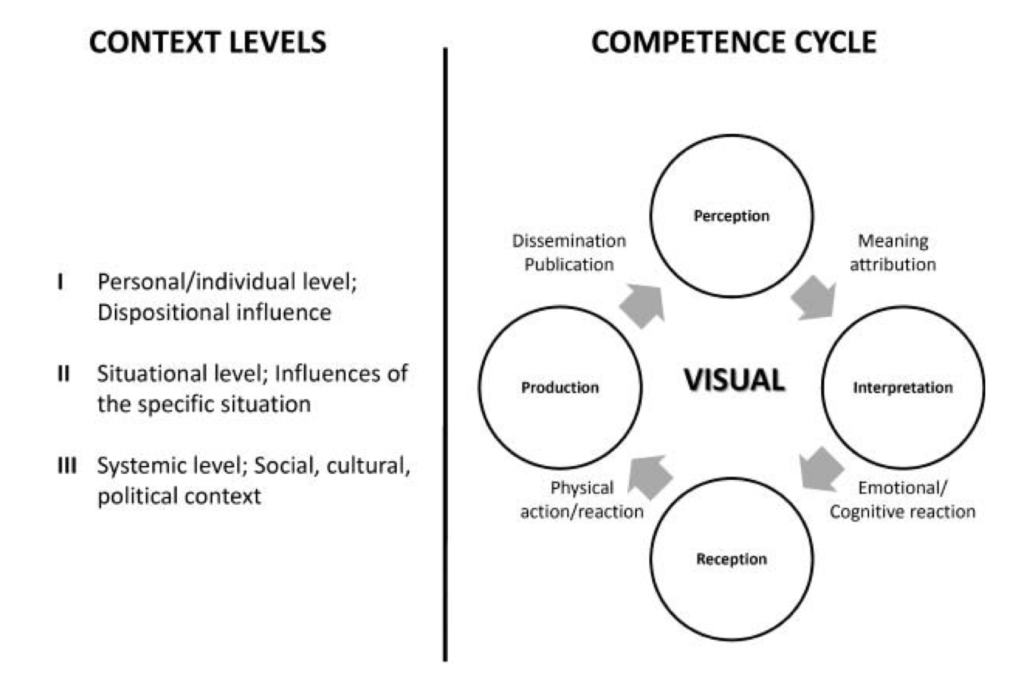Titel: Design als zentraler Erfolgsfaktor bei Start-ups und deren Produkten
Universität: Karl-Franzens-Universität Graz
Betreuer: Weiß, Gerold, Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.soc.oec. MBA
Autorin: Alijana Bosnic, Bakk.rer.soc.oec.
Datum: April 2013
Designebene Die Masterarbeit wurde zur Erlangung des akademischen Grades eines Master of Science der Studienrichtung Betriebswirtschaft an der Universität Graz verfasst. Für die Laufschrift wurde die Times New Roman (12 Punkt) und für den Titel und Überschriften die Arial (12 und 16 Punkt) verwendet. Die Gestaltung ist schlicht und klar strukturiert. Sie hebt sich nicht durch eine besondere Gestaltung hervor. Diagramme und Statistiken helfen sich einen Überblick zu verschaffen.
Innovationsgrad Der Innovationsgrad ist gering. Themen wie Unternehmensgründung, Marketing und seine Instrumente, Designlehre, Produktentwicklung, Urheberrecht und Erfolgsfaktoren werden ausführlich behandelt.
Die Unabhängigkeit Die Verfasserin hat die Arbeit selbstständig geschrieben, es bestand keine Kooperation mit Firmen. Lediglich der Betreuer Herr Weiß wird in der Danksagung erwähnt.
Gliederung und Struktur Das Thema wird im Inhaltsverzeichnis klar strukturiert und bearbeitet. Der Aufbau ist logisch und es lässt sich ein roter Faden durch die Arbeit erkennen. Eine inhaltliche Orientierung ist gut möglich. Im Anschluss an das Inhaltsverzeichnis ist das Abbildungsverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis angeführt. Das Literaturverzeichnis befindet sich am Ende der Arbeit. Übersichtlicher ist es, wenn alle Verzeichnisse am Ende angeführt sind.
Grad der Kommunikation Durch Schwerpunktsetzung gelingt eine auf nachvollziehbare Weise sachlich sinnvolle Betrachtung des Themas. Die Verfasserin greift auf bereits vorhandenes Wissen zurück und setzt dieses Wissen in Fallbeispielen ein. Sie hat eine selbstständige Art der Argumentation gefunden und verweist dabei auf Forschungsliteratur die ihre Argument unterstützen.
Umfang der Arbeit Mit 82 Seiten ist der Umfang der Masterarbeit durchschnittlich groß.
Orthographie und Genauigkeit Um objektive Aussagen zu treffen hat die Verfasserin oft Passivsätze eingesetzt. Die Sätze sind nicht durch unnötig eingeschobene Nebensätze oder gehäufte Attribute auseinander gerückt und somit gut verständlich.
Literatur Die Verfasserin verweist in der Literaturliste auf 21 Bücher (darunter befinden sich anerkannte Fachbücher) und 9 Internetquellen. Die Literatur ist mit einem Veröffentlichungsdatum von vor 6 bis 2 Jahren angemessen aktuell.
Quelle